Medizinische Poliklinik
Medizinische Poliklinik
Universitätsspital Basel
Petersgraben 4
4031 Basel
Ärztinnen, Ärzte und Fachspezialist*innen









Sprechstunden
Seltene Krankheiten/Erwachsene ohne Diagnose
Manche Menschen leiden unter Beschwerden sowie objektivierbaren, auffälligen Befunden in der klinischen Untersuchung oder im Labor – ohne dass trotz umfangreicher Abklärungen bislang eine zufriedenstellende Diagnose gestellt werden konnte.
Die Medizinische Poliklinik des Universitätsspitals Basel bietet eine interdisziplinäre Plattform für Betroffene. Hier stellen wir solche Fälle einem fachübergreifenden Expert*innen-Board vor. Dieses setzt sich aus Spezialist*innen verschiedener medizinischer Disziplinen zusammen.
In manchen Fällen kann es notwendig sein, dass Sie zunächst in einer allgemeinen oder spezialisierten Sprechstunde vorgestellt werden, bevor Ihr Fall dem interdisziplinären Board präsentiert wird. Gemeinsam prüfen wir unter Berücksichtigung der bereits vorliegenden Befunde, ob eine seltene Erkrankung als Ursache in Frage kommt und welche weiteren diagnostischen Schritte sinnvoll wären.
Trotz aller Bemühungen und des Einsatzes modernster universitärer Medizin gibt es Fälle, in denen keine Diagnose gefunden werden kann. Auch in solchen Situationen setzen wir alles daran, Sie bei der Bewältigung Ihrer Beschwerden bestmöglich zu unterstützen.
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt über das Zentrum für Seltene Krankheiten.
Bitte beachten Sie: Wir bearbeiten ausschliesslich Zuweisungen durch Ihre behandelnde Ärztin oder Ihren behandelnden Arzt. Diese müssen eine Zusammenfassung der bisherigen Abklärungen sowie eine klare Fragestellung hinsichtlich einer vermuteten, noch nicht gestellten Diagnose enthalten.
Wartezeit und Kontaktaufnahme:
Aufgrund begrenzter Ressourcen und der hohen Zahl an Anfragen kann es mehrere Monate dauern, bis Sie von uns kontaktiert werden. Eine telefonische Kontaktaufnahme ist nicht erforderlich und führt nicht zu einer schnelleren Bearbeitung. Jede Anfrage wird gleichwertig geprüft und intern nach medizinischer Dringlichkeit priorisiert.

Dr. Katrin Bopp
Kaderärztin

Prof. Mike Recher
Leitender Arzt
Klinische Immunologie / Immunschwäche
Hypertonie und kardiovaskuläre Risikofaktoren
Die Hypertonie und andere kardiovaskuläre Risikofaktoren sind ein Hauptinteresse der Medizinischen Poliklinik (MedPol).
Dank der engen Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen unseres Spitals (Kardiologie, Endokrinologie/Diabetologie/Klinische Ernährung, Gynäkologie, Nephrologie, Angiologie, Radiologie) können in unserer Sprechstunde Hypertonie-Patient*innen und Patient*innen mit kardiovaskulären Risikofaktoren interdisziplinär abgeklärt und behandelt werden. Neben der Hypertonie liegt ein weiterer Fokus auf dem Gebiet der Lipidstoffwechselstörungen
Die Hypertoniesprechstunde des Unispital Basel ist durch die Europäische Gesellschaft für Hypertonie als Exzellenzzentrum (ESH Hypertension Centre of Excellence) anerkannt.
Die Betreuung der Patienten mit Bluthochdruck und/oder Lipidstoffwechselstörung geschieht in enger Zusammenarbeit mit der zuweisenden Hausärztin, dem zuweisenden Hausarzt.
Wir bieten Folgendes an:
- Umfassende und moderne Diagnostik
- Abklärung und Behandlung von unkomplizierten und komplexen Hypertonien
- Abklärung und Behandlung von therapieresistenten Hypertonien
- Abklärung und Behandlung von sekundären Hypertonien
- Behandlung von Schwangerschafts-assoziierten Hypertonien
- Vorabklärung und Nachbetreuung bei interventionellen Verfahren der Blutdruckbehandlung (renale Denervierung)
- Second Opinion
- Abklärung und Behandlung von Lipidstoffwechselstörungen

PD Dr. Thilo Burkard
Stv. Chefarzt
Kaderarzt Kardiologie
Immunologie-Sprechstunde
Wir beraten und behandeln Patientinnen und Patienten mit immunologischen Erkrankungen und Fragestellungen. Hierbei formuliert ein interdisziplinäres Ärzte-Team individuelle Abklärungspläne und erarbeitet Therapiestrategien. Neben spitalinterner klinischer Vernetzung und eigner, Patienten-orientierter Forschung ist das Immunologie-Team auch hervorragend international vernetzt. Dies stellt sicher dass alle aktuellsten Erkenntnisse aus der Forschung in die Behandlung der meist seltenen immunologischen Erkrankungen einfliessen.
Im Zentrum unserer Expertise stehen die entzündlich-systemischen Autoimmunerkrankungen mit speziellem Fokus auf den (i) Gefässentzündungen (Vaskuliitis-Sprechstunde), (ii) Immunschwächen (Immundefizienz Sprechstunde), sowie der Impfberatung (Impfsprechstunde – inkl. komplexen Fragestellungen wie beispielsweise Impfungen bei immunsupprimierten Patientinnen und Patienten).
Impfsprechstunde
Impfung ist eine einfache und sehr effiziente Massnahme um sich vor Infektionen zu schützen. Dies ist v.a. wichtig, wenn das Immunsystem durch Alter, Erkrankungen oder immunologische Therapien geschwächt wird. Neben der sogenannten Basis-Immunisierung (gegen Mumps, Masern, Röteln, Tetanus, Influenza, Affenpocken) sind bei Reisen in bestimmte Regionen spezielle Impfungen notwendig. Die Impfsprechstunde am Universitätsspital Basel ist akkreditiert und alle in der Schweiz zugelassenen Impfungen können verabreicht werden.
In der Impfsprechstunde beraten wir gerne alle, die
- Ihren Impfschutz prüfen und auffrischen wollen (dies beinhaltet auch alle Routineimpfungen)
- Sich wegen einer Abwehrschwäche speziell beraten und impfen lassen wollen (inklusive Alter, Patienten unter immunsuppressiver Therapie, Knochenmark- oder Organ-Transplantierte, bei Milzentfernungen etc...)
- Eine Reise planen und sich bezüglich Prophylaxe beraten lassen wollen
- Als Fachpersonen Patientinnen und Patienten betreuen, und daher spezielle Impfungen benötigen
- Nach Impfungen eine schwere Nebenwirkung hatten oder allergisch reagiert haben (Abklärung in der immunologischen Sprechstunde)
Termine
Termine können online oder telefonisch vereinbart werden.
Öffnungszeiten: Dienstag 8.30–12.00 Uhr und 13.30–16.30 Uhr.
Für Gruppenimpfungen von über 5 Personen (z.B. für Angestellte oder spezifische Gruppen) nehmen sie am besten direkt mit Dr. Christoph Berger (christoph.berger@usb.ch) Kontakt auf um einen massgeschneiderte Lösung zu finden.
Neben der Impfberatung führen wir zusammen mit dem Schweizerischen Tropeninstitut eine regelmässige Weiterbildungsveranstaltung für interessierte Fachpersonen zum Thema Reisemedizin und Impfen durch.
Tel. +41 61 265 50 05
Lipid-Sprechstunde
In unserer Lipidsprechstunde behandeln wir Patient*innen mit erhöhten Blutfetten (Lipiden), die von Hausärzt*innen, Kardiolog*innen oder weiteren Fachärzt*innen zugewiesen werden.
Veränderungen von bestimmten Blutfetten wie Cholesterin, LDL-Cholesterin oder Lipoprotein (a) spielen eine zentrale Rolle für das Auftreten von Herz-Kreislauferkrankungen. Dazu zählen die Verengung der Herzkranzgefässe (KHK), Herzinfarkt, Verengungen der Beinarterien (Schaufensterkrankheit) sowie die Verengung der hirnversorgenden Gefässe und Schlaganfälle. Bei schweren Triglyceriderhöhungen besteht die Gefahr einer akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung.
Lebensstilfaktoren wie Ernährung, Bewegung und Rauchen haben einen entscheidenden Einfluss auf den Fettstoffwechsel. Zusätzlich spielen genetische Veranlagungen eine wichtige Rolle, sodass neben einer Lebensstilanpassung häufig eine medikamentöse Behandlung notwendig ist. Durch eine gezielte Therapie können wir das Risiko, an einer Herz-Kreislauferkrankung zu erkranken, dauerhaft senken.
In unserer Sprechstunde beurteilen wir anhand Ihrer Krankengeschichte, einer körperlichen Untersuchung und einer speziellen Laboranalytik ihr persönliches kardiovaskuläres Risiko und geben eine individuell auf Sie abgestimmte Therapieempfehlung ab. Ein Schwerpunkt liegt in der Behandlung von Patient*innen mit bereits manifester Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems oder familiärer Fettstoffwechselstörung, die von einer besonders strikten Einstellung der Blutfette profitieren, um weitere Ereignisse wie z.B. einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu verhindern.
Unser Ziel ist eine individuelle, leitliniengerechte Betreuung und Therapie unserer PatientInnen entsprechend ihres persönlichen kardiovaskulären Risikoprofils.
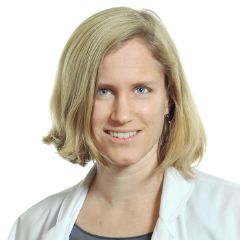
Dr. Lilian Anna Maria Sewing
Oberärztin
Nierensteinsprechstunde
Nierensteine sind ein häufiges Leiden. Betroffene merken erst dann etwas, wenn es zu einer, mitunter sehr schmerzhaften, Nierenkolik kommt (Steinabgang über die Harnleiter). Leider haben Betroffene nach einer ersten Nierenkolik ein erhöhtes Risiko auch in Zukunft weiter Koliken zu erleiden.
Die Nierenstein-Sprechstunde hat das Ziel das Risiko für die Bildung von neuen Steinen und somit das Risiko von erneuten Koliken zu reduzieren. Eine Zuweisung in die Nierenstein-Sprechstunde wird empfohlen:
- Nach Erstereignis eines Steinleidens bei familiärer Belastung (d.h. Mutter/Vater oder Geschwister leiden ebenso an Nierensteinen).
- Nach Erstereignis eines Steinleidens bei Betroffenen mit einer bekannten entzündlichen Darmerkrankung, nach einer Entfernung von Teilen des Dünndarms/Magens, mit erhöhten Harnsäurewerten oder Gichtanfällen, wiederholten Harnwegsinfekten.
- Bei gehäuften Episoden einer Nierenkolik
Die enge Zusammenarbeit zwischen Urologen, Radiologen und Nephrologen bietet eine optimale Versorgung der Nierensteinpatienten mit dem Ziel eine erneute Nierensteinbildung zu verhindern.
Post Covid / Fatigue Sprechstunde
Unser Angebot richtet sich an Betroffene ab 16 Jahren mit dem Leitsymptom Fatigue/Leistungsintoleranz.
Wir erheben in einem Erstgespräch eine ausführliche Anamnese und leiten daraus unsere weiteren diagnostischen und therapeutischen Schritte ab.
Unser Team
Wir arbeiten interprofessionell, interdisziplinär und multimodal. Unser Team besteht aus Fachpersonen der Inneren Medizin, Psychosomatik, Physiotherapie und Ergotherapie. Wir hören Ihnen zu, begleiten Sie und ermutigen Sie.
Hier finden Sie weitere Informationen zum Thema Fatigue
Fatigue bezeichnet eine unverhältnismässige Erschöpfung, die manchmal schon durch alltägliche Aktivitäten ausgelöst wird und zu relevanten Belastungen im Privat- und Berufsleben führen kann. Auslösend ist häufig ein Zusammenspiel von biologischen Faktoren (z.B. Infektionen wie COVID-19 und andere Erkrankungen) mit psychosozialen Belastungen (z.B. anhaltender Stress, schwierige Lebensumstände).
Häufig berichten Betroffene über:
- Geistige/ körperliche Erschöpfung, die durch Ruhe nicht gelindert wird.
- Überempfindlichkeit gegenüber äusseren Reizen wie Licht, Lärm und Gerüchen.
- Körperbeschwerden wie Muskel- und Gelenkschmerzen, Schwindel, Herzklopfen, Muskelschwäche.
Diagnostik
- Bis heute gibt es keinen spezifischen Biomarker, mit dem Fatigue nachgewiesen werden kann.
- Je nach Symptomatik und Stand der Vorabklärungen braucht es weitere Untersuchungen, um Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen (z.B. Blutarmut, Schilddrüsenerkrankungen) auszuschliessen.
Erklärungsmodell
Nach über 40-jähriger Fatigue-Forschung geht man heute davon aus, dass Fatigue nicht auf eine einzelne Ursache zurückzuführen ist, sondern durch ein komplexes Zusammenspiel von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren zustande kommt. Aktuelle Forschung zeigt: Oft stecken hinter Fatigue eine Überaktivität und Fehlregulation im zentralen und autonomen Nervensystem, was dazu führt, dass der Körper nicht mehr richtig zur Ruhe kommt. Deshalb braucht es ein ganzheitliches Verständnis und eine Behandlung, die Körper, Psyche und Umfeld mit einbezieht.
Therapieangebot
Unser multimodales Therapieangebot soll Sie beim Erlernen von Strategien unterstützen, mit denen Sie das überreaktive Nervensystem besser regulieren können. Ziel ist eine Fokusverlagerung weg vom Symptom hin zu Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten trotz zunächst fortbestehender Beschwerden. Dadurch kann Ihre Selbstwirksamkeit erhöht und die Funktionalität im Alltag verbessert werden.
Fatigue ist unserer Erfahrung nach behandelbar.
- Fatigue-orientierte Physiotherapie: Da mittlerweile mehrere Studien zeigen konnten, dass moderates physiotherapeutisch angeleitetes aerobes Ausdauertraining hilfreich und nicht schädlich ist (1), empfehlen wir ein solches allen Patient*innen. Das Training wird individuell auf das Ausmass von Fatigue, Dekonditionierung und Begleitsymptomatik (Schmerzen, Angst, Posturales Tachykardie-Syndrom = POTS) angepasst. Ziele sind, die Wiederaufnahme und Steigerung körperlicher Aktivität zu begleiten, Vertrauen in den eigenen Körper zurückzugewinnen, ein positives Körpererleben zu fördern. Ergänzend bieten wir bei unbewusster Hyperventilationsneigung Atemphysiotherapie mit Übungen zur Atemwahrnehmung, Instruktion von Nasen-/Bauchatmung und Entspannungstechniken an.
- Fatigue-orientierte Ergotherapie: Fokus auf Energie- und Belastungsmanagement (Pacing gemäss den 4 P: Planung, Prioritäten, Pause, Psyche/Positiv bleiben) sowie individuelle Beratung hinsichtlich hilfreicher Strategien im Privat- sowie Berufsalltag.
- Fatigue-orientierte Psychotherapie: Studien zeigen, dass Betroffene von kognitiver Verhaltenstherapie profitieren (2). Ziele sind, persönliche Ressourcen zu erkennen und im Umgang mit der Erkrankung zu stärken, belastende Stressoren zu identifizieren und das Zusammenspiel von Angst, Symptomen und Vermeidung besser zu verstehen. Bei Bedarf beraten wir zu medikamentösen Optionen und unterstützen Sie dabei, einen externen Psychotherapieplatz zu finden.
- Unterstützung bezüglich Arbeitsfähigkeit/Schulproblemen und Finanzen: Zusammenarbeit mit Sozialdienst, Case Management, Arbeitgeber*innen und IV-Stellen.
Die grösstmögliche Besserung Ihrer Lebensqualität können Sie dann erreichen, wenn Sie trotz fortbestehender Symptome im Rahmen Ihrer Möglichkeiten aktiv mitwirken.
Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg.
Ihr Team der Fatigue-/ Post-COVID-Sprechstunde
Universitätsspital Basel

Dr. Katrin Bopp
Kaderärztin

Dr. Andrea Meienberg
Kaderärztin
Rauchstopp-Sprechstunde
Rauchen ist nach wie vor der wichtigste Risikofaktor für das Auftreten von Lungen-, Herz-, Gefäss- und Krebserkrankungen. Rauchen schädigt unsere Gesundheit massiv.
Die beste und wichtigste persönliche Gesundheitsvorsorge ist deshalb ein Rauchstopp. Dies ist aber leichter gesagt als getan. Das Nikotin in den Zigaretten führt zu einer körperlichen und seelischen Abhängigkeit, weshalb der Prozess mit dem Rauchen aufzuhören schwierig sein kann.
Um Sie auf diesem Weg nachhaltig zu unterstützen, bietet die Medizinische Poliklinik eine individuelle Rauchstopp-Sprechstunde an, die sich an alle Personen richtet, welche mit dem Rauchen aufhören wollen.
Wir bieten Folgendes an
- Erstgespräch mit Erfassung der Rauchgewohnheiten im Alltag
- Aufklärung über die verschiedenen Wirkungen des Tabaks und den entsprechenden Symptomen bei Entzug
- Festlegung der individuellen Entwöhnungsstrategie und Tipps und Tricks bei Auftreten von Entzugserscheinungen
- Möglichkeiten der medikamentösen Unterstützung
- Individuelle Betreuung und Motivation während des Rauchstopps, sowie Beratung zur Vorbeugung einer Gewichtszunahme und Strategien gegen einen Rückfall

PD Dr. Thilo Burkard
Stv. Chefarzt
Kaderarzt Kardiologie

Denise Casanova
Mitarbeiterin Rauchstoppberatung

Dr. Andrea Meienberg
Kaderärztin
Sprechstunde für hereditäre Kardiomyopathien und Ionenkanalkrankheiten
Sprechstunde für Patientinnen und Patienten mit seltenen, möglicherweise genetischen Herzmuskelerkrankungen und Herzrhythmusstörungen, sowie ihre Familienmitglieder. Die Sprechstunde wird in Zusammenarbeit von der Kardiologie mit der Medizinischen Poliklinik durchgeführt.
Wir bieten Diagnostik inkl. Familienabklärung und medizinische/kardiologische Betreuung bei Verdacht auf oder bestätigter Diagnose seltener Herzerkrankungen.
Sie werden von uns ein Aufgebot für Sprechstundentermine und ggf. Diagnostik wie EKG, signalgemitteltes EKG, Langzeit-EKG, Echokardiographie und/oder Belastungstests erhalten. Bei Bedarf werden wir in der Sprechstunde weitere Untersuchungen mit Ihnen besprechen. Zusammen mit dem Aufgebot erhalten Sie einen Fragebogen zu Erkrankungen in Ihrer Familie, da einige der dieser Erkrankungen in der Familie gehäuft auftreten können. Bitte bringen Sie uns allfällige Unterlagen von früheren Herzuntersuchungen mit.

PD Dr. Annina Salome Vischer
Kaderärztin

Prof. Christian Sticherling
Stv. Chefarzt
Leiter Elektrophysiologie
